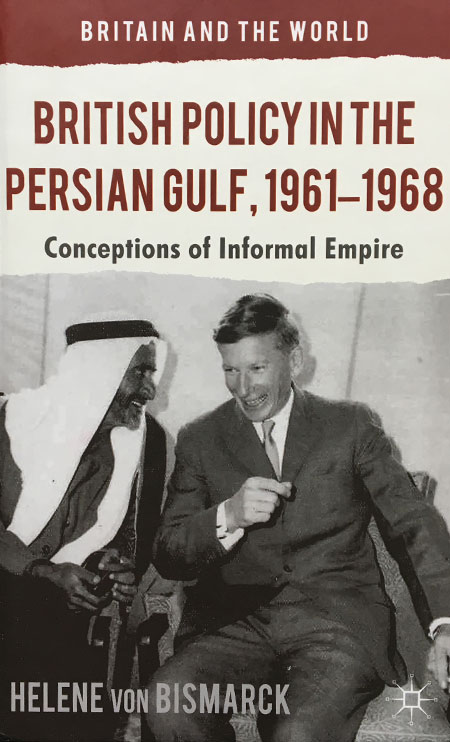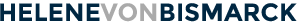Conceptions of Informal Empire. British Policy in the Persian Gulf, 1961-68
(Basingstoke/ New York: Palgrave Macmillan 2013)
ISBN 978-1-137-32672-0
Helene von Bismarcks erstes Buch ist ein Beitrag zu drei verschiedenen Forschungsfeldern: der Geschichte des britischen Weltreiches, der internationalen Geschichte, und der Regionalgeschichte des Nahen und Mittleren Ostens. Das Buch untersucht Großbritanniens Politik im erdölreichen Persischen Golf im Zeitraum zwischen der Unabhängigkeit Kuwaits im Juni 1961 und der Entscheidung der britischen Regierung im Januar 1968, sich militärisch vollständig aus den Gebieten östlich des Suezkanals zurückzuziehen. Es ist eine Studie der inneren Logik und der Methoden des britischen Imperialismus zu einer Zeit, als große Teile der europäischen Weltreiche den Dekolonisationsprozess durchlebten oder sogar schon abgeschlossen hatten. Anstatt zu fragen, warum Großbritannien sich letztendlich aus der Golfregion zurückzog, analysiert Helene von Bismarck, wie die Briten ihre weitreichenden wirtschaftlichen und strategischen Interessen dort sicherten, bevor es zum Rückzug kam. Für den Großteil der 1960er Jahre wurde Großbritanniens Golfpolitik nicht von der Unvermeidlichkeit der Dekolonisation, sondern von einem zentralen Dilemma bestimmt: wie konnte man das britische informal empire im Golf aufrechterhalten, ohne nach außen hin allzu imperialistisch zu wirken? Die Beantwortung dieser Frage kam einer Quadratur des Kreises gleich.
Die britischen Entscheidungsträger definierten Großbritanniens Rolle im Golf als interdependentes System aus militärischen Präsenz, vertraglich zugesicherten Vorrechten und politischer Einflussnahme. Dieses System schloss die konstitutionell abhängigen Länder Bahrain, Qatar und die sieben Trucial States (die heutigen Vereinigten Arabischen Emirate) genauso ein, wie die formell unabhängigen Staaten Kuwait und Oman. Die kleinen Golfstaaten verfügten über einen enormen Reichtum an natürlichen Ressourcen, aber sie waren durch die Ambitionen der größeren Anrainerstaaten des Golfs, Saudi Arabien, Irak und Iran extrem gefährdet. Aus Sicht der britischen Regierung bildete der Persische Golf ein Machtvakuum, das von Großbritannien ausgefüllt werden musste. Die enormen Profite, die Ölfirmen wie British Petroleum (BP) und Royal Dutch Shell im Golf machten, kamen Großbritanniens Zahlungsbilanz in signifikanter Weise zugute. Die britischen Entscheidungsträger hofften zwar auf die grundsätzliche Unterstützung der US Regierung, versuchten aber eine direkte Einflussnahme der Amerikaner auch das Tagesgeschäft der kleinen Golfstaaten zu vermeiden. Die größte Herausforderung für Großbritannien war es, die ungestörte Ölproduktion im Golf und den Verkauf des Öls in den Westen zu günstigen Konditionen zu gewährleisten, ohne die Aufmerksamkeit der arabischen Nationalisten oder der Vereinten Nationen auf sich zu ziehen.
Die britische Macht im Persischen Golf hing vom Vertrauen und der Kooperation der lokalen Herrscher ab. Wenn ein Herrscher sich kategorisch weigerte, mit Großbritannien zusammenzuarbeiten, was in Sharjah 1965 und in Abu Dhabi 1966 geschah, organisierte die britische Regierung heimlich seinen Sturz und ersetzte ihn mit einem anderen Mitglied der jeweiligen Herrscherfamilie. Helene von Bismarck beweist und erklärt in ihrem Buch als erste die Beteiligung der britischen Regierung bei den Absetzungen der Shaikhs Saqr bin Sultan Al-Qasimi von Sharjah, und Shakhbut bin Sultan Al-Nahyan von Abu Dhabi.
Conceptions of Informal Empire beruht größtenteils auf Recherchen in den National Archives des Vereinigten Königreichs in Kew bei London. Die National Archives and Records Administration der USA in College Park, Maryland, wurden als zusätzliche Quelle genutzt.
Das Buch ist in zahlreichen einschlägigen Fachzeitschriften positiv besprochen worden, u.a. im American Historical Review (PDF), dem Journal for British Studies (PDF), dem Middle East Journal (PDF), dem Journal of Arabian Studies (PDF), Diplomacy and Statecraft, Middle Eastern Studies und Asian Affairs.
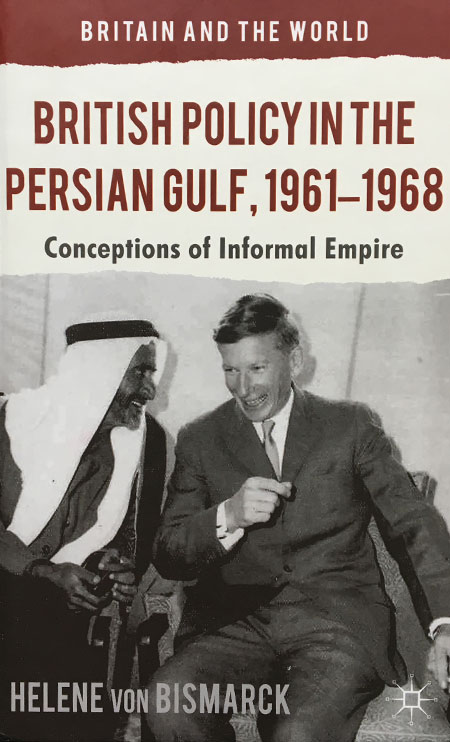
Neues Projekt
(Basingstoke/ New York: Palgrave Macmillan 2013)
ISBN 978-1-137-32672-0
Helene von Bismarcks erstes Buch ist ein Beitrag zu drei verschiedenen Forschungsfeldern: der Geschichte des britischen Weltreiches, der internationalen Geschichte, und der Regionalgeschichte des Nahen und Mittleren Ostens. Das Buch untersucht Großbritanniens Politik im erdölreichen Persischen Golf im Zeitraum zwischen der Unabhängigkeit Kuwaits im Juni 1961 und der Entscheidung der britischen Regierung im Januar 1968, sich militärisch vollständig aus den Gebieten östlich des Suezkanals zurückzuziehen. Es ist eine Studie der inneren Logik und der Methoden des britischen Imperialismus zu einer Zeit, als große Teile der europäischen Weltreiche den Dekolonisationsprozess durchlebten oder sogar schon abgeschlossen hatten. Anstatt zu fragen, warum Großbritannien sich letztendlich aus der Golfregion zurückzog, analysiert Helene von Bismarck, wie die Briten ihre weitreichenden wirtschaftlichen und strategischen Interessen dort sicherten, bevor es zum Rückzug kam. Für den Großteil der 1960er Jahre wurde Großbritanniens Golfpolitik nicht von der Unvermeidlichkeit der Dekolonisation, sondern von einem zentralen Dilemma bestimmt: wie konnte man das britische informal empire im Golf aufrechterhalten, ohne nach außen hin allzu imperialistisch zu wirken? Die Beantwortung dieser Frage kam einer Quadratur des Kreises gleich.
Die britischen Entscheidungsträger definierten Großbritanniens Rolle im Golf als interdependentes System aus militärischen Präsenz, vertraglich zugesicherten Vorrechten und politischer Einflussnahme. Dieses System schloss die konstitutionell abhängigen Länder Bahrain, Qatar und die sieben Trucial States (die heutigen Vereinigten Arabischen Emirate) genauso ein, wie die formell unabhängigen Staaten Kuwait und Oman. Die kleinen Golfstaaten verfügten über einen enormen Reichtum an natürlichen Ressourcen, aber sie waren durch die Ambitionen der größeren Anrainerstaaten des Golfs, Saudi Arabien, Irak und Iran extrem gefährdet. Aus Sicht der britischen Regierung bildete der Persische Golf ein Machtvakuum, das von Großbritannien ausgefüllt werden musste. Die enormen Profite, die Ölfirmen wie British Petroleum (BP) und Royal Dutch Shell im Golf machten, kamen Großbritanniens Zahlungsbilanz in signifikanter Weise zugute. Die britischen Entscheidungsträger hofften zwar auf die grundsätzliche Unterstützung der US Regierung, versuchten aber eine direkte Einflussnahme der Amerikaner auch das Tagesgeschäft der kleinen Golfstaaten zu vermeiden. Die größte Herausforderung für Großbritannien war es, die ungestörte Ölproduktion im Golf und den Verkauf des Öls in den Westen zu günstigen Konditionen zu gewährleisten, ohne die Aufmerksamkeit der arabischen Nationalisten oder der Vereinten Nationen auf sich zu ziehen.
Die britische Macht im Persischen Golf hing vom Vertrauen und der Kooperation der lokalen Herrscher ab. Wenn ein Herrscher sich kategorisch weigerte, mit Großbritannien zusammenzuarbeiten, was in Sharjah 1965 und in Abu Dhabi 1966 geschah, organisierte die britische Regierung heimlich seinen Sturz und ersetzte ihn mit einem anderen Mitglied der jeweiligen Herrscherfamilie. Helene von Bismarck beweist und erklärt in ihrem Buch als erste die Beteiligung der britischen Regierung bei den Absetzungen der Shaikhs Saqr bin Sultan Al-Qasimi von Sharjah, und Shakhbut bin Sultan Al-Nahyan von Abu Dhabi.
Conceptions of Informal Empire beruht größtenteils auf Recherchen in den National Archives des Vereinigten Königreichs in Kew bei London. Die National Archives and Records Administration der USA in College Park, Maryland, wurden als zusätzliche Quelle genutzt.
Das Buch ist in zahlreichen einschlägigen Fachzeitschriften positiv besprochen worden, u.a. im American Historical Review (PDF), dem Journal for British Studies (PDF), dem Middle East Journal (PDF), dem Journal of Arabian Studies (PDF), Diplomacy and Statecraft, Middle Eastern Studies und Asian Affairs.
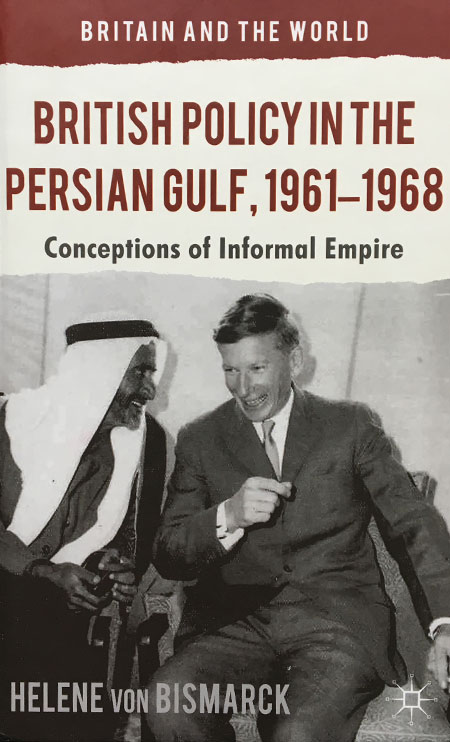
Königswinter
(Basingstoke/ New York: Palgrave Macmillan 2013)
ISBN 978-1-137-32672-0
Helene von Bismarcks erstes Buch ist ein Beitrag zu drei verschiedenen Forschungsfeldern: der Geschichte des britischen Weltreiches, der internationalen Geschichte, und der Regionalgeschichte des Nahen und Mittleren Ostens. Das Buch untersucht Großbritanniens Politik im erdölreichen Persischen Golf im Zeitraum zwischen der Unabhängigkeit Kuwaits im Juni 1961 und der Entscheidung der britischen Regierung im Januar 1968, sich militärisch vollständig aus den Gebieten östlich des Suezkanals zurückzuziehen. Es ist eine Studie der inneren Logik und der Methoden des britischen Imperialismus zu einer Zeit, als große Teile der europäischen Weltreiche den Dekolonisationsprozess durchlebten oder sogar schon abgeschlossen hatten. Anstatt zu fragen, warum Großbritannien sich letztendlich aus der Golfregion zurückzog, analysiert Helene von Bismarck, wie die Briten ihre weitreichenden wirtschaftlichen und strategischen Interessen dort sicherten, bevor es zum Rückzug kam. Für den Großteil der 1960er Jahre wurde Großbritanniens Golfpolitik nicht von der Unvermeidlichkeit der Dekolonisation, sondern von einem zentralen Dilemma bestimmt: wie konnte man das britische informal empire im Golf aufrechterhalten, ohne nach außen hin allzu imperialistisch zu wirken? Die Beantwortung dieser Frage kam einer Quadratur des Kreises gleich.
Die britischen Entscheidungsträger definierten Großbritanniens Rolle im Golf als interdependentes System aus militärischen Präsenz, vertraglich zugesicherten Vorrechten und politischer Einflussnahme. Dieses System schloss die konstitutionell abhängigen Länder Bahrain, Qatar und die sieben Trucial States (die heutigen Vereinigten Arabischen Emirate) genauso ein, wie die formell unabhängigen Staaten Kuwait und Oman. Die kleinen Golfstaaten verfügten über einen enormen Reichtum an natürlichen Ressourcen, aber sie waren durch die Ambitionen der größeren Anrainerstaaten des Golfs, Saudi Arabien, Irak und Iran extrem gefährdet. Aus Sicht der britischen Regierung bildete der Persische Golf ein Machtvakuum, das von Großbritannien ausgefüllt werden musste. Die enormen Profite, die Ölfirmen wie British Petroleum (BP) und Royal Dutch Shell im Golf machten, kamen Großbritanniens Zahlungsbilanz in signifikanter Weise zugute. Die britischen Entscheidungsträger hofften zwar auf die grundsätzliche Unterstützung der US Regierung, versuchten aber eine direkte Einflussnahme der Amerikaner auch das Tagesgeschäft der kleinen Golfstaaten zu vermeiden. Die größte Herausforderung für Großbritannien war es, die ungestörte Ölproduktion im Golf und den Verkauf des Öls in den Westen zu günstigen Konditionen zu gewährleisten, ohne die Aufmerksamkeit der arabischen Nationalisten oder der Vereinten Nationen auf sich zu ziehen.
Die britische Macht im Persischen Golf hing vom Vertrauen und der Kooperation der lokalen Herrscher ab. Wenn ein Herrscher sich kategorisch weigerte, mit Großbritannien zusammenzuarbeiten, was in Sharjah 1965 und in Abu Dhabi 1966 geschah, organisierte die britische Regierung heimlich seinen Sturz und ersetzte ihn mit einem anderen Mitglied der jeweiligen Herrscherfamilie. Helene von Bismarck beweist und erklärt in ihrem Buch als erste die Beteiligung der britischen Regierung bei den Absetzungen der Shaikhs Saqr bin Sultan Al-Qasimi von Sharjah, und Shakhbut bin Sultan Al-Nahyan von Abu Dhabi.
Conceptions of Informal Empire beruht größtenteils auf Recherchen in den National Archives des Vereinigten Königreichs in Kew bei London. Die National Archives and Records Administration der USA in College Park, Maryland, wurden als zusätzliche Quelle genutzt.
Das Buch ist in zahlreichen einschlägigen Fachzeitschriften positiv besprochen worden, u.a. im American Historical Review (PDF), dem Journal for British Studies (PDF), dem Middle East Journal (PDF), dem Journal of Arabian Studies (PDF), Diplomacy and Statecraft, Middle Eastern Studies und Asian Affairs.